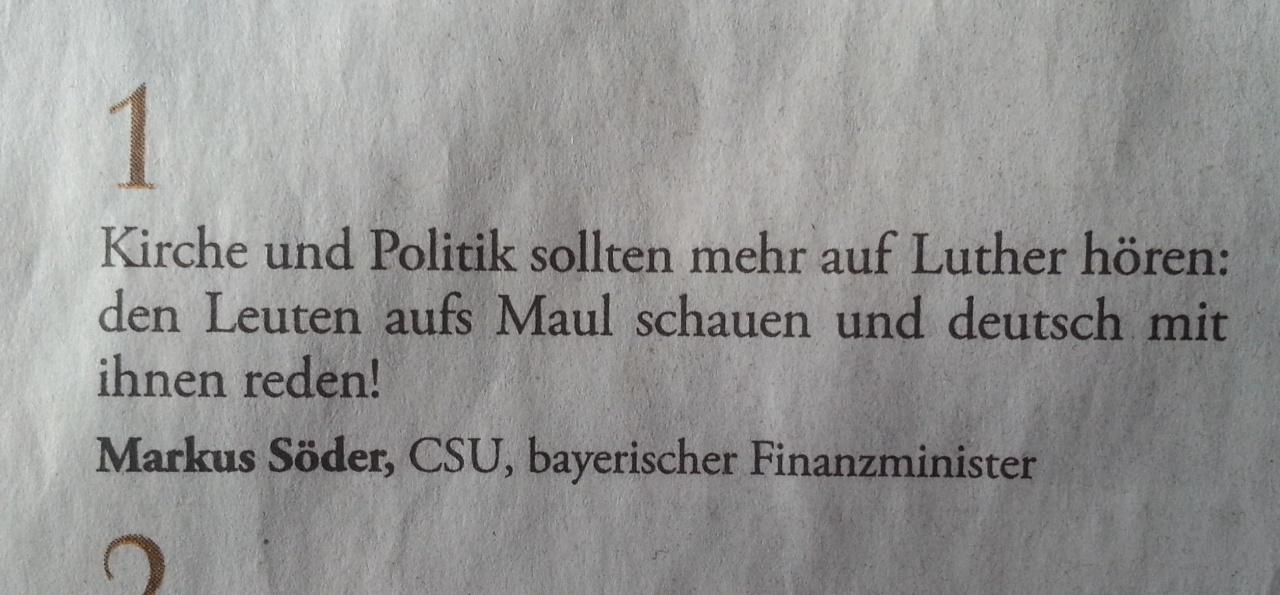Wenn Kirchen und Kondome kollidieren, lässt der Skandal nicht lange auf sich warten. Das gilt auch noch im Jahr 2017.
Es muss wohl am Wochenende des 11./12. März dieses Jahres gewesen sein, als die Düsseldorfer Jugendkirche Kondome an Jugendeinrichtungen verteilte, und zwar mit – wie es in der Formulierung des Evangelischen Pressedienstes (epd) hieß – „provokanten Sprüchen“. Zu lesen war auf den Kondomverpackungen unter anderem „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, „Für Huren und Heilige“, „Schrei vor Erlösung“ oder „Nageln bis der Papst kommt“.
Nun, wahrscheinlich hätte von dieser Verteilaktion kaum jemand etwas mitbekommen, außer denjenigen, welche die Idee dazu hatten, den Jugendlichen, welche die Kondome benutzt hätten und den Spermien, die in ihrem natürlichen Verteilungsdrang aufgehalten worden wären, wenn, ja, wenn nicht die Evangelische Kirche im Rheinland die Aktion unterbunden und bereits ausgeteilte Kondome wieder eingesammelt hätte.
Die rheinische Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer begründete in einem Schreiben das Verbot damit, dass die Luther-Aussagen aus ihrem historischen und inhaltlichen Zusammenhang gerissen worden seien und in der vorliegenden Kondomverpackungsform sexistisch und verletzend wirken könnten. Klaus Eberl, Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland, hat sich sogar mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt, um zu erläutern, „was da nicht geht“. Die Jugenddelegierten der Evangelischen Kirche in Deutschland haben ihrerseits in einem offenen Brief auf Facebook auf das Verbot reagiert.
Wichtigstes Argument zur Verhütung der weiteren Verteilung der Verhütungsmittel ist die Achtsamkeit gegenüber denjenigen Mädchen und Frauen, die als Opfer sexueller Gewalt solche Sprüche auf Kondomverpackungen nicht nur witzig finden können. Damit ist ein wichtiger Punkt benannt, weil mit diesem Thema wahrlich nicht zu spaßen ist. Trotzdem hinterlässt das Kondomverbot den Eindruck einer gewissen doppelmoralischen Scheinheiligkeit. Wäre denn die Aufregung ähnlich groß gewesen, wenn es sich nicht um Luthersprüche beziehungsweise Lutheranspielungen gehandelt hätte? Hätten die Kirchenoberen ähnlich empfindlich und vor allem öffentlichkeitswirksam reagiert, wenn auf den Verpackungen ein paar andere, nicht lutheraffine Sprachpreziosen zu lesen gewesen wären? Wäre die Aufregung geringer ausgefallen, wenn es nicht der Heilige Martin der Evangelischen Kirche gewesen wäre, der hier als Sprücheklopfer herhalten musste? Und könnten die Opfer sexueller Gewalt möglicherweise insofern nur ein vorgeschobenes Argument gewesen sein, als diese sich bei jeder Form von sexuellen Anspielungen zumindest unangenehm berührt (wenn nicht Schlimmeres) fühlen müssen, Kondome also in jedem Fall für solche Aktionen ausfallen müssen, ganz gleich, welche Sprüche sich darauf befinden? Und wieso hat die Evangelische Kirche zwar Probleme damit, aus dem Zusammenhang gerissene Lutheranspielungen auf Kondomverpackungen drucken zu lassen, wenn sie doch selbst solche Textfragmente auf T-Shirts, Babystrampler, Aufkleber, Bonbontüten, Kaffeetassen oder Regenponchos aufbringt und zu wohlfeilen Preisen im eigenen Reformationsjubiläumsshop anbietet? Wie muss zum Beispiel der auf Socken gedruckte Spruch, „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, auf Menschen wirken, die im Rollstuhl sitzen?
Wenn Klaus Eberl in seiner Videobotschaft sagt, „Gewalt und Sex gehen für uns nicht zusammen, auch nicht in der Sprache“, dann kann man diese Aussage nur unterschreiben. Gleichzeitig hat die Evangelische Kirche aber weniger Probleme damit, Kommerz und Jubiläum zusammenzubringen und Kleidung, überflüssige Accessoires oder Nahrungsmittel zu verkaufen, bei denen vielleicht noch zu klären wäre, wo sie unter welchen Bedingungen produziert worden sind und ob hier nicht möglicherweise eine bedenkliche Form kapitalistischer Ausbeutung vorliegt. Und selbst wenn sie in der Stadtteilwerkstatt um die Ecke hergestellt worden sein sollten, stellt sich immer noch die Frage, weshalb man mit Luthers Sprache zwar Geld verdienen, aber keinen Sex haben darf.
Das Kondomverbot führt uns also einmal mehr an die Wurzel des Problems, das man mit diesem Reformationsjubiläum haben kann. Ich finde es verständlich und nachvollziehbar, dass nicht alle von flotten Witzen auf Kondomverpackungen amüsiert sind. Ich finde es auch nicht grundsätzlich verwerflich, Schlüsselanhänger oder Picknickdecken mit Lutherrosen zu verkaufen. Die Schwierigkeiten entstehen im einen wie im anderen Fall, wenn man versucht, 500 Jahre alte Inhalte ohne Umschweife in die Gegenwart zu transferieren. Dann zeigt sich nämlich entweder, dass man die Reformation zwar so lange weichspülen kann, bis sich damit auch Frühstücksbrettchen unter die Leute bringen lassen – oder dass dieses Geschehen, in einen anderen Zusammenhang gestellt, seine ganze Unerbittlichkeit und auch Gewaltsamkeit offenbart. Es wäre wohl angebracht, wenn historische Geschehnisse nicht zur Spielwiese unbedarfter Aktualisierungen würden, weder bei Kondomen noch im Online-Shop. Doch beim Reformationsjubiläum 2017 muss man schon länger den Eindruck haben, dass es für eine solche Einsicht bereits zu spät ist.